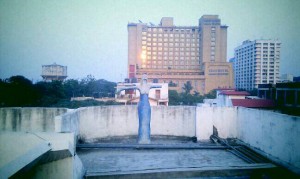Wie man ein Journalistenvisum in Indien verlängert
 Wenn Einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Aber vorher muss er vorbereiten; und das bedeutet im Groben: Flug, Unterkunft und Visum besorgen. Gerade Letzteres bereitet manchen urbanen Business-Nomaden Kopfzerbrechen: Was braucht man denn jetzt? Wirklich ehrlich sein und gemäß der Reiseziele beantragen oder doch irgendwie mit einem Touristenvisum durchschummeln? Da ich ein durch und durch ehrlicher Mensch bin, entschied ich mich für Ersteres: Ich beantragte ein Journalistenvisum, das man mir aber nur für Single-Entry, gültig für drei Monate ausstellte. Verlängern könne ich dieses aber in Delhi bei einer speziellen Behörde, teilte mir die indische Botschaft in Wien mit.
Wenn Einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Aber vorher muss er vorbereiten; und das bedeutet im Groben: Flug, Unterkunft und Visum besorgen. Gerade Letzteres bereitet manchen urbanen Business-Nomaden Kopfzerbrechen: Was braucht man denn jetzt? Wirklich ehrlich sein und gemäß der Reiseziele beantragen oder doch irgendwie mit einem Touristenvisum durchschummeln? Da ich ein durch und durch ehrlicher Mensch bin, entschied ich mich für Ersteres: Ich beantragte ein Journalistenvisum, das man mir aber nur für Single-Entry, gültig für drei Monate ausstellte. Verlängern könne ich dieses aber in Delhi bei einer speziellen Behörde, teilte mir die indische Botschaft in Wien mit.
Im Vorfeld war dann die Angst geschürt worden: Dass Willkür herrscht, dass in diesem Land ja Jeder korrupt ist, und dass noch niemals ein Journalist eine Verlängerung bekommen habe. Also habe ich mir einen dreifachen Rettungsschirm zugelegt: Zusätzlich zu allen anderen Dokumenten verschiedenster Art besorgte ich mir in Wien noch ein Schreiben meines Chefredakteurs, mit dem er bescheinigte, dass mein Medium die volle Verantwortung für meine Handlung übernimmt und ich in ihrem Auftrag reise; zweitens führte mich mein erster Weg in Delhi in die österreichische Außenhandelsstelle, von der mir ebenfalls ein Schreiben ausgestellt wurde, das um die Verlängerung meines Visums bittet und bescheinigt, dass ich ein guter Kerl bin.
Mit diesen Dokumenten führte mich mein Weg ins MEA (Raum 137, im Shastri Bhawan), wo einem ein weiteres Schreiben ausgestellt wird, mit dem man dann zur Ausländermeldebehörde FRRO geht – klingt bürokratisch, ist aber so. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Dokumenten werden weitere Dokumente gebraucht, darunter eine Bestätigung des aktuellen Vermieters über den Wohnort (auch Hotels können entsprechende Schreiben ausstellen), Kopie von Pass und Visa, Passbilder und eine Meldung im indischen Presseclub – in meinem Fall hat aber auch ein internationaler Presseausweis des Wiener Journalistenclub gereicht.
Die Bearbeitung des Dokuments dauert dann eine gewisse Zeit, in meinem Fall habe ich eine Woche warten müssen. Dafür ist dann mein erhofftes Schreiben bei der Abholung aber auch ganz prominent in einem Kuvert an einer Pinnwand gehangen, und die freundlichen Beamten haben mir gar angeboten, mit ihnen zu Mittag zu essen.
Am nächsten Tag ging es zur Ausländermeldebehörde FRRO. Dort war ich allerdings vollkommen falsch, wie ich feststellen musste. Denn obwohl ein junger Herr frohen Mutes direkt vor dem Amt an ahnungslose Ausländer Formulare verkauft, lassen sich Visa-Verlängerungen seit August 2011 nur noch online erreichen, nämlich unter der Website http://www.immigrationindia.nic.in/ – das entsprechende Formular muss ausgedruckt und bei der Einreichung des Antrags mit gebracht werden. Unklar dabei ist den Beamten teils, wie viele Exemplare des Formulars wirklich gebraucht werden: Nur ein Ausdruck, drei oder gar vier? Die Meinungen der Beamten (die nur wenige Meter von einander entfernt saßen) gingen auseinander. In meinem Fall wurden vier gebraucht, ich hatte aber nur drei Ausdrucke dabei – und musste dann gegen Ende meines Antragstellungsprozesses das Gebäude verlassen, um noch extra eine Kopie zu machen.
Abgesehen von besagten Formularen und dem Schreiben des MEA braucht man auf dem Weg zur FRRO: Wieder die Bestätigung des Vermieters/Hotels, etliche Passbilder, viel Zeit und ein gutes Buch zum Lesen. Denn man wartet – in meinem Fall habe ich einen halben Tag in dem Gebäude der FRRO verbracht. Aber es ist okay, denn man darf sitzen und lernt nette Menschen kennen – vom Hippie über den Journalisten bis zum Top-Manager muss jeder Ausländer zur FRRO, der sein Visum verlängern möchte oder sich registrieren muss, weil er länger als sechs Monate in Indien bleibt.
Der Ablauf sieht dann so aus: Zuerst wartet man außerhalb des Gebäudes, bis man herein gelassen wird. Dann Warten bei der „Reception“. Von dort geht man weiter zum „Document Submission Desk“ und gibt seine Unterlagen ab. Diese werden von zwei Beamten eine Zeit lang geprüft – meistens trinkt mindestens einer von Beiden Tee, während die Ausländer sie wartend anstarren. Wird der eigene Name dann aufgerufen, so ist das wie die Ankunft des Messias – und man darf mit den entsprechenden Dokumenten zu einem weiteren Beamten, der jene Dokumente abtippt, die zuvor digital ausgefüllt und anschließend ausgedruckt worden waren. Die Digitalisierung-Haptisierung-Kette wird fortgesetzt, indem der Beamte anschließend auf einen „Print“-Knopf druckt und der Ausländer zu einem Drucker zu gehen, um seine Meldung und eine Bestätigung der Visum-Verlängerung abzuholen. Im Pass selbst wird ein Stempel hinterlassen, der anschließend durch kraklige Schrift ergänzt wird. Dann geht es schließlich zur Zahlstelle, und abschließend unterschreibt der Abteilungschef noch alles.
Fertig.
Ist das jetzt aufwändig? Stefan-typisch wäre wohl, sich über Bürokratie zu ärgern. Aber ehrlich gesagt: Das will ich an dieser Stelle gar nicht. Denn natürlich muss man verschiedene Stellen durchlaufen. Und natürlich braucht man viele Dokumente. Aber ist das in anderen Ländern anders? Ich denke nicht. Die meisten Menschen, die ich im Lauf des Prozesses kennen gelernt hab, waren extrem höflich. Nur der Typ, der vor dem Ministerium steht und Formulare verkauft, der sollte sich wohl ein anderes Geschäftsfeld suchen – denn irgendwann wird auch der letzte Hippie verstanden haben, dass Indien im Zeitalter des E-Government angekommen ist.