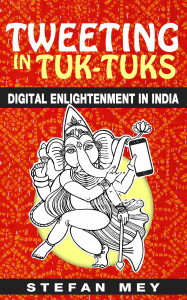Früher mussten Spiele-Entwickler die Früchte ihrer Arbeit von einem Konzern auf DVDs pressen lassen, um sie im Handel zu verkaufen. Musiker galten nur als erfolgreich, wenn sie einen Plattenvertrag hatten. Authoren konnten ohne Verlage nicht publizieren. Und Händler hielten sich brav an die vorgegeben „unverbindlichen Preisempfehlungen“ der produzierenden Konzerne. Heutzutage ist all dies Vergangenheit.
Denn Spiele-Entwickler vertreiben ihre Mini-Games inzwischen über den AppStore von Apple, Androids GooglePlay oder demnächst auch den Store von Windows 8. Musiker brauchen keinen Vertrag mehr, sondern stellen ihre Musik mit Hilfe on Rebeat, INgrooves oder Reverbnation auf iTunes oder Spotify direkt dem Fan zur Verfügung. Authoren publizieren auf Amazon, Ciando oder bod.de ihre Bücher ohne Mittelmann. Und Händler entdecken über die Marktplätze von Amazon und eBay neue Vertriebskanäle.
Das ist eine schöne neue Welt, in der Wirtschaften eine zuvor noch nie dagewesene Freiheit erlebt. Aber das schmeckt nicht jedem.
Denn während sich die Content-Produzenten und Händler am Web erfreuen, ärgern sich etablierte Unternehmen über Gewinneinbußen: Die Videospiel-Branche etwa sieht eine vermehrte Konkurrenz durch die von kleinen Start-Ups produzierten Handy-Spiele, die nur einen Bruchteil kosten, die Spieler aber ebenfalls fesseln können – Branchenriese Electronic Arts rechnet heuer mit einem Minus von bis zu 100 Millionen Dollar. Und auch die Musikindustrie klagt seit Jahren über sinkende Gewinne.
Es wäre möglich, selbst kreative Ansätze zu entwickeln und in diesem Spiel der Innovationen mit zu spielen – was auch manche Unternehmen erfolgreich tun. Andere Vertreter der Old Economy wiederum ziehen es vor, gegen den Strom zu schwimmen. Exemplarisch ist dabei das Festhalten der Musikindustrie an konventionellem Vertrieb – inklusive matraartigem Wiederholen der Aussage, die CD dürfe nicht sterben; ebenso wie die Vorgabe des Sportartikel-Herstellers Adidas, die Händler sollen künftig nicht mehr die Vertriebskanäle von Amazon und eBay verwenden – Begründung: Die Darstellung der Produkte erfolgt bei Amazon und eBay nicht zufriedenstellend. Frage: Was kann man bei der Darstellung einer Sport-Tasche großartig falsch machen?
Erreichen kann Adidas durch diese Strategie lediglich, dass die vorgegebenen Preise in bestehenden Vertriebskanälen erhalten bleiben. Auf die neuen Vertriebskanäle hingegen verzichtet man – und wenn der Kunde beim Online-Marktplatz seines Vertrauens dann keinen Adidas-Schuh findet, kauft er halt einfach ein Produkt der Konkurrenz.
Fakt ist, dass in den vergangenen Jahren ein Damm aufgebrochen ist, der sich nun entleert und ein neues Wirtschaften ermöglicht. Was wir nun parallel dazu erleben, ist ein verzweifeltes Aufbäumen der Old Economy, das Kunden eher verärgert, statt sie glücklich zu machen. Und verärgerte Kunden will niemand haben. Etablierte Unternehmen tun daher gut daran, im digitalen Spiel mit zu spielen, statt sich dagegen zu stemmen – denn aufhalten lässt sich die Revolution ohnehin nicht mehr.
Aus Gründen der Effizienzmaximierung erschien dieser Artikel auch in der TechZone des WirtschaftsBlatt.