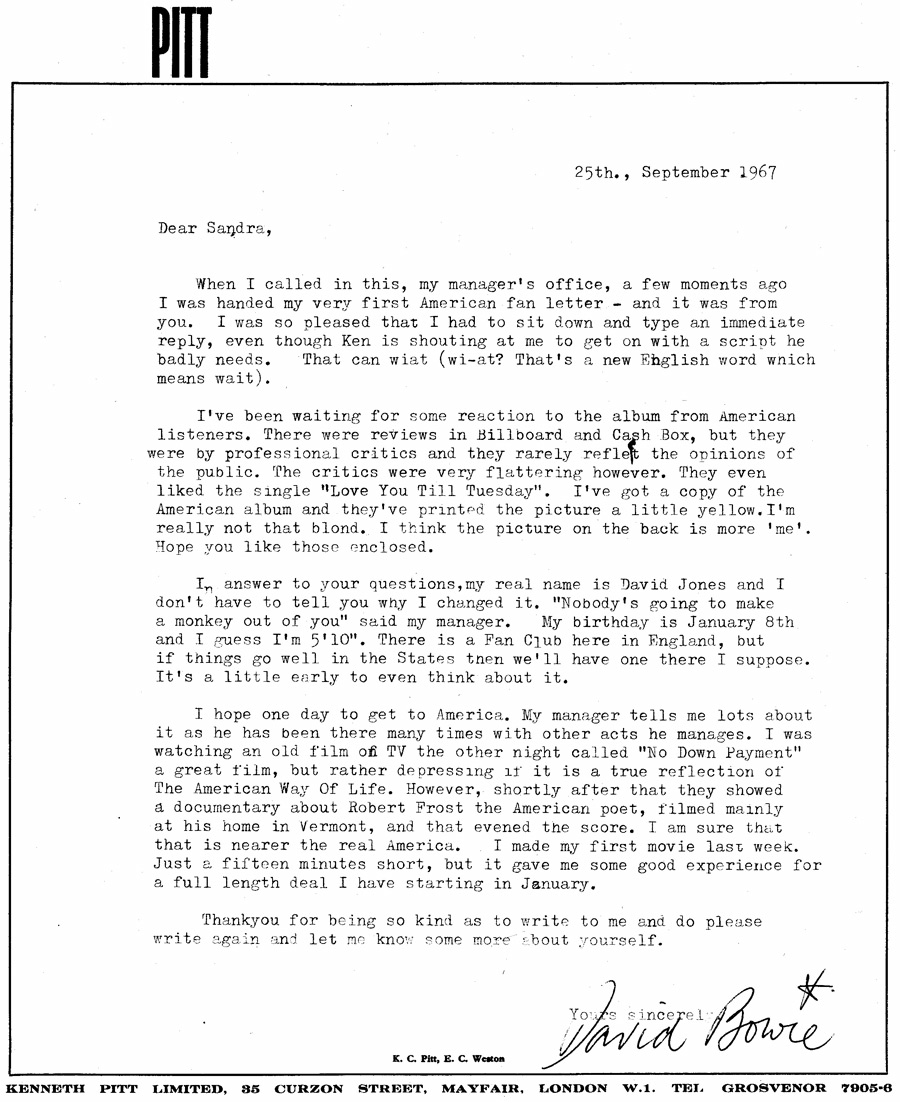„Mein Privatleben ist ein Witz, den mir niemand erklären wird“
„Mach mal Platz, Thom Yorke, ich habe jetzt einen neuen Helden“, habe ich mir gestern gedacht, nachdem ich das neue Album der US-Rocker Bright Eyes, „The people’s key“ gut zwei Wochen rauf und runter gehört habe: Frontman Conor Oberst, der schon im Alter von 13 Jahren Musik aufnahm, hat die Erwartungen übertroffen und sein wohl bisher bestes Album geschaffen.
Und das schreibt jemand, der monatelang zu einem der vorherigen Meisterwerke – „I’m Wide awake, it’s Morning“ – jeden Morgen aufgewacht ist. Denn dafür war es perfekt: Langsame, verliebte Stücke wie „Lua“ oder „First day of my life“ leiteten den Tag ein, bis uns ein kreischender Oberst im finalen „Road To Joy“ doch aus dem Bett brüllte. Das Album war voller Neo-Country; andere LPs wie „Fevers and Mirrors“ oder „Digital Ash in a Digital Urn“ begeisterten durch ihre verspielt-experimentellen Elemente.
„The People’s key“ ist nun das, was man auch in europäischen Radios spielen kann. Die erste Single, „Shell Games“, ist etwa ein poppiges Liebeslied mit swingenden Gitarrenriffs und poppigen Keyboard-Einlagen – romantisch und mitreißend zugleich, ohne kitschig zu sein. „My private life is an inside joke, noone will explain it to me“,singt Oberst da etwa. Oder er ist „pissed in vinigar“ und „angry, with no reason to be“ – Gedankenfutter für ehemalige Oldschool-Emos.
Wieder ganz anders hingegen die zweite Single „Haile Selassie“ – der äthiopische Regent, der als Pate der Reggae-Bewegung gilt, hat Obers hier ebenfalls inspiert: Am Besten lässt sich das Stück wohl als eine Art „Neo-Reggae“ bezeichnen – „pilgrim across the water“ und „hitchhiking our way to Zion“ sind Text-Fetzen, die dies implizieren, so wie das liebevoll dem Hörer zu gerufene: „You got a soul, use it!“. Off-Beat, wie im alten Reggae üblich, gibt es hier aber nicht; stattdessen regieren die gerade heraus gespielten Gitarren – Im Gegensatz zum Abschluss des Meisterwerks, dem verträumten „One for you, one for me“: Hier dient die Gitarre nur noch zum Abspielen verträmter Flanger-Riffs; den Rhythmus gibt das Keyboard mit seinen spacigen Sounds vor. Der Hörer wird schließlich mit einem wohligen Gefühl zurück gelassen – und der Überzeugung: Bright Eyes haben es hier geschafft, die hoch gesteckten Erwartungen der Fans noch zu übertreffen. In Facebook-Slang gesagt: I like.
Alles im Netz
Warum die Fans das Album bereits hören konnten, bevor es in den Shops erhältlich war, wird man sich nun fragen. Illegale Downloads und geleakte Songs können eine Erklärung sein, sind es aber nicht. Stattdessen hat die Band verstanden, dass man der Raubkopierer-Community zuvor kommen muss – auf dem eigenen YouTube-Account wurde somit hochoffiziell das gesamte Album hoch geladen. Ist das dumm? Auf den ersten Blick schon, weil ja offensichtlich der Reiz zum CD-Verkauf weg fällt.
Aber andererseits: Würde die Band das Album nicht selbst hochladen, so würden die technikaffinen Hörer es sich selbst von illegalen Tauschbörsen ziehen. Und zumindest für mich hat sich durch diese Strategie ein Wandel eingestellt: Nachdem ich das Album nun lange genug probe gehört habe, kann ich es kaum erwarten, wenn Rave-Up-Records kommende Woche die Vinyl-Version im Angebot hat. Die werde ich mir nämlich dann kaufen – zu einem deutlich höherem Preis als dem, was ich früher für eine CD gezahlt hätte. Aber das ist es mir einfach wert, weil ich die Musik spitze finde, die Offenheit im Umgang mit neuen Medien schätze und die Band auf jeden Fall fördern möchte. Ich würde ja auch auf ein Konzert gehen – aber leider kommen Bright Eyes nicht nach Wien; und die Konzerte in Berlin und Amsterdam sind schon ausverkauft.
So, und nun halte ich auch schon wieder Klappe – und wünsche viel Spaß mit der folgenden YouTube-Version des Albums.