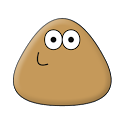„Welches Smartphone soll ich mir kaufen?“
 Ich werde öfters von Freunden und Kollegen um Rat gebeten, welches Smartphone sie sich kaufen sollen – immerhin teste ich diese Dinger ja beruflich und habe somit einen etwas breiteren Blick auf das Thema als der durchschnittliche Fanboy, der seinen Gesprächspartner im Zeugen-Jehovas-Stil von der Überlegenheit der eigenen Marke überzeugen möchte.
Ich werde öfters von Freunden und Kollegen um Rat gebeten, welches Smartphone sie sich kaufen sollen – immerhin teste ich diese Dinger ja beruflich und habe somit einen etwas breiteren Blick auf das Thema als der durchschnittliche Fanboy, der seinen Gesprächspartner im Zeugen-Jehovas-Stil von der Überlegenheit der eigenen Marke überzeugen möchte.
Es gibt nämlich deshalb unterschiedliche Produkte auf dieser Welt, weil es auch unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gibt. Daher frage ich meine Gesprächspartner meistens zuerst, wie viel Geld sie ausgeben wollen und was sie mit dem Ding machen wollen – und basierend auf den Antworten gibt es dann vier unterschiedliche Konsumenten-Typen, zu denen eine entsprechende Sorte Smartphone passt:
1. „Ich will nicht viel Geld ausgeben, hatte bisher noch kein Smartphone und möchte bloß Mailen/Surfen/Fotos machen“
Diese Menschen brauchen kein teures High-End-Gerät, sondern sind mit einem günstigen Android-Einsteigerhandy bestens bedient – um 100 bis 200 Euro kriegen sie ein Smartphone, mit dem sie Mailen, Surfen und Fotografieren können. Sicher: Alles geht etwas langsamer und die Foto-Qualität ist nicht berauschend – aber die Grundbedürfnisse sind mal gedeckt. Wer ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, kauft sich ein Nexus 4 – meiner Meinung nach das Smartphone mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das schon recht gute Leistung zu einem passablen Preis bietet.
Wer mutig ist, der kann statt Android auch auf ein Einsteiger-Modell mit Windows Phone setzen. Vorteile: Sieht fetzig aus, vor allem die Nokia-Geräte machen recht gute Fotos. Nachteil: Das Angebot an Apps ist verglichen mit der Konkurrenz noch immer sehr dürftig.
2. „Geld ist mir relativ egal. Das Gerät soll eine gute Leistung bringen. Sonst will ich mir über nichts Gedanken machen. Und außerdem mag ich Apple“
Dann kauf Dir ein iPhone. Apples Smartphone ist zwar ziemlich langweilig und wird am Stammtisch keine neugierigen Blicke auf sich ziehen – bis auf ein paar kleine Zickereien funktioniert es aber tadellos. iPhone-User müssen sich wenig Gedanken machen; Apps und Musik werden ohne Probleme runter geladen, die Kamera ist ab Version 4 durchaus brauchbar und böse Malware gibt es auch so gut wie nicht. Nachteil: Für den Komfort muss man bei Apple immer mit der Freiheit bezahlen – Apps von Drittanbietern haben zum Beispiel nicht so viele Berechtigungen wie bei Android.
Ein Gedanke noch zum Thema Preis-Leistung: Es muss nicht immer das neueste Modell sein. Den Spracherkennungs-Dienst Siri habe ich ein paar Mal verwendet, danach hat er mich nur noch gelangweilt – wer auf solche Spielereien, ein bisschen mehr Rechenleistung und ein etwas besseres Display verzichten kann, kommt mit einem Modell aus der Vorsaison deutlich günstiger weg.
3. „Ich hatte bisher ein iPhone und will jetzt etwas anderes haben“ und/oder „Ich mag Apple nicht“
Es gibt Menschen, die bereits länger ein iPhone haben und nun davon gelangweilt sind. Oder Apple einfach von Haus aus nicht mögen, weil ihnen zum Beispiel die Firmenpolitik nicht zusagt. Diese Menschen sind mit einem High-End-Android-Smartphone bestens bedient; unterschiedliche Geräte gibt es hier wie Sand am Meer, und einige heben sich durch zusätzliche Features hervor: Das Samsung Galaxy S4 punktet etwa mit allgemein extrem guter Hardware, das Sony Xperia Z ist wasserfest und das HTC One stellt Nachrichten direkt auf dem Startscreen dar (was ideal für News-Junkies wie mich ist). Wer die Wahl hat, der hat hier die Qual – und muss sich wohl die einzelnen Geräte im Detail anschauen, um sie mit seinen eigenen Präferenzen abzuwägen.
4. „Geld spielt keine Rolle. Ich will das Gerät voll ausnützen und immer den neusten Scheiß haben“
Du brauchst nicht ein Smartphone, sondern zwei: Ein iPhone der jüngsten Generation und ein High-End-Android-Handy. Denn eierlegende Wollmilchsäue gibt es nicht; mit beiden Systemen würde man früher oder später an seine Grenzen stoßen – zum Beispiel erscheinen manche Apps und Spiele nur für das iPhone, während aber Android bei der Kompatibilität mit anderen Geräten die Nase vorn hat. Wer also Beides haben will, der muss sich auch beide Geräte kaufen. Aber Du hast ja eh gesagt, dass Geld keine Rolle spielt. Alternativ könntest Du dir überlegen, eines der beiden Systeme auf einem Tablet statt auf einem Smartphone laufen zu lassen. Damit wirkt man nicht ganz so extrem wie ein Nerd, der ständig mit zwei Handys in der Gegend rum rennt.
Ich hoffe, dass ich den Hilfesuchenden unter Euch mit diesen Tipps eine Orientierung bieten konnte – und freue mich schon jetzt auf das Bashing diverser Fanboy-Fraktionen. Bitte nutzt dafür die Kommentar-Funktion am Ende des Artikels. Danke.